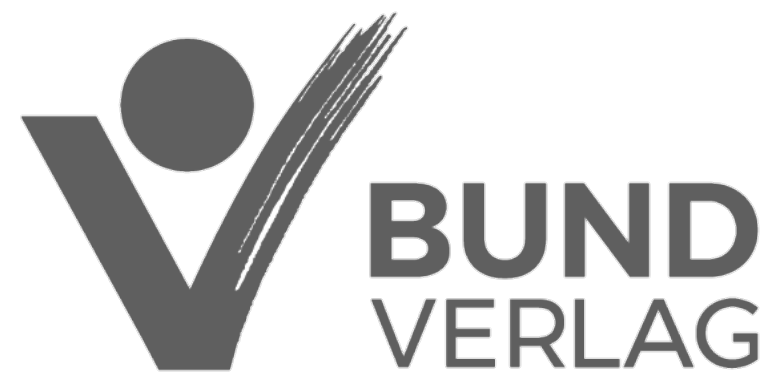Kinderbetreuung im öffentlichen Dienst: Rechte und Möglichkeiten bei Ausfall
Fehlende Kinderbetreuung stellt berufstätige Eltern regelmäßig vor große Herausforderungen. Besonders Alleinerziehende sind betroffen, wenn kurzfristig kein Kindergarten, keine Schule oder Tagespflege verfügbar ist. Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst – sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamte – stellt sich in solchen Fällen die Frage: Welche Rechte bestehen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn? Was ist freiwillig, was ist verpflichtend geregelt?
Typische Gründe für Probleme bei der Kinderbetreuung
- Kein Kita-Platz verfügbar (z. B. U3-Knappheit, Wartelisten)
- Schließung von Kita oder Schule (z. B. wegen Krankheit, Personalmangel, Streik, Quarantäne)
- Verkürzte Betreuungszeiten oder eingeschränkte Angebote
- Ausfall der Tagespflegeperson
- Plötzliche Erkrankung des Kindes
- Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung oder beim Wechsel in eine neue Einrichtung
- Fehlende Inklusionsangebote für Kinder mit besonderem Bedarf
- Lange Anfahrtswege zu verfügbaren Betreuungseinrichtungen
- Besondere Belastung bei Alleinerziehenden, da keine zweite betreuende Person vorhanden ist
Was bedeutet das für Eltern im öffentlichen Dienst?
Wenn Betreuungseinrichtungen nicht zur Verfügung stehen, brauchen berufstätige Eltern kurzfristige Lösungen. Für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst gelten bestimmte arbeitsrechtliche Regelungen. Beamte fallen unter beamtenrechtliche Vorgaben. Beide Gruppen sind auf eine Kombination aus Rechtsansprüchen, Kulanz und betrieblicher Flexibilität angewiesen.
1. Anspruch auf bezahlte Freistellung (§ 616 BGB)
Nach § 616 BGB haben Beschäftigte das Recht auf eine kurzzeitige bezahlte Freistellung, wenn sie aus einem unverschuldeten, persönlichen Grund an der Arbeit gehindert sind – etwa bei einer plötzlichen Kita-Schließung. Dieser Anspruch gilt jedoch nur für wenige Tage und kann durch Arbeits- oder Tarifverträge (z. B. TVöD) eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.
2. Kinderkrankentage (§ 45 SGB V)
Eltern gesetzlich versicherter Kinder haben Anspruch auf Kinderkrankengeld, auch wenn das Kind gesund ist, aber nicht betreut werden kann – z. B. bei pandemiebedingter Schließung. Nach § 45 SGB V stehen pro Elternteil bis zu 30 Arbeitstage pro Kind zur Verfügung (für Alleinerziehende bis zu 60 Tage pro Kind und Jahr).
3. Home-Office und mobiles Arbeiten
Viele Tätigkeiten im öffentlichen Dienst lassen sich – zumindest zeitweise – im Home-Office erledigen. Ein gesetzlicher Anspruch darauf besteht jedoch nicht. Die Entscheidung liegt beim Arbeitgeber bzw. der Dienststelle. Gerade bei kurzfristigen Ausfällen zeigen viele Verwaltungen kulante Regelungen, insbesondere bei Alleinerziehenden.
4. Überstundenabbau und Gleitzeit
Wo Arbeitszeitkonten bestehen, kann der kurzfristige Abbau von Überstunden oder das Nutzen von Gleitzeit eine pragmatische Lösung sein. Diese Option wird oft zuerst geprüft, bevor bezahlte oder unbezahlte Freistellungen gewährt werden.
5. Sonderurlaub, unbezahlte Freistellung und Urlaub
Falls keine anderen Möglichkeiten bestehen, können Eltern unbezahlten Sonderurlaub nach § 28 TVöD oder unbezahlte Freistellung nach § 29 Absatz 3 Satz 2 TVöD beantragen. Auch der Einsatz von Erholungsurlaub nach § 26 TVöD ist eine Option – muss aber mit dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber abgestimmt werden. In Notsituationen sind viele Dienststellen bereit, kurzfristig zu reagieren – besonders bei alleinerziehenden Elternteilen, die sonst keine Betreuungsmöglichkeit haben.
6. Sonderregelungen für Beamte
Für Beamte gelten je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen. Ein Anspruch auf Freistellung bei fehlender Betreuung besteht nicht generell. In der Praxis werden jedoch arbeitsorganisatorische Lösungen wie Home-Office, flexible Arbeitszeiten oder kurzfristiger Sonderurlaub angeboten – besonders bei akuten familiären Notlagen.
Gibt es eine feste Reihenfolge bei den Maßnahmen?
Gesetzlich vorgeschrieben ist keine feste Reihenfolge. In der Praxis hat sich jedoch folgende Reihenfolge etabliert:
- Abbau von Gleitzeit und Überstunden
- Prüfung von Home-Office oder mobiler Arbeit
- Beantragung von Kinderkrankentagen (§ 45 SGB V)
- Bezahlte Freistellung nach § 616 BGB (wenn nicht ausgeschlossen)
- Unbezahlte Freistellung oder Urlaub
Die rechtzeitige und transparente Kommunikation mit der Dienststelle ist entscheidend, um individuell passende Lösungen zu finden.
Rechtsgrundlagen im Überblick
- § 616 BGB: Bezahlte Freistellung bei vorübergehender Verhinderung
- § 45 SGB V: Anspruch auf Kinderkrankengeld – auch bei Kita-/Schulschließung
- TVöD/TV-L: Regelungen für Tarifbeschäftigte (einschließlich Ausschluss von § 616 BGB)*
- Landesbeamtengesetze, BBG: Beamtenrechtliche Vorgaben zur Arbeitszeit und Sonderurlaub
*Erläuterungen: In § 29 TVöD bzw. (§ 29 TV-L) ist die Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts geregelt. Demnach kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – etwa bei unvorhergesehener Schließung der Betreuungseinrichtung – eine bezahlte Freistellung für einen kurzen Zeitraum gewährt werden. Gleichzeitig regelt § 616 BGB ergänzend die Möglichkeit einer bezahlten Freistellung bei vorübergehender Verhinderung, wird jedoch durch den TVöD/TV-L teilweise vertraglich ausgeschlossen oder eingeschränkt (siehe jeweilige Tarifverträge, § 29 Abs. 1). Weitere relevante Vorschriften finden sich in den tariflichen Regelungen zur Arbeitszeit (§ 6 TVöD / § 6 TV-L) und zu Gleitzeit bzw. Arbeitszeitkonten, die bei kurzfristigem Betreuungsbedarf Flexibilität schaffen können.
Fazit:
Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben bei Problemen mit der Kinderbetreuung nur in begrenztem Umfang gesetzlich gesicherte Ansprüche. Viele Lösungen beruhen auf freiwilligen Regelungen der Dienststellen oder auf Einzelfallentscheidungen. Umso wichtiger ist es, gut informiert und proaktiv zu handeln – gerade für alleinerziehende Elternteile, die häufig ohne familiären Rückhalt auskommen müssen.
In unseren Foren können Sie sich kostenlos austauschen und Ihre Erfahrungen teilen. Beispielhafte Themen: