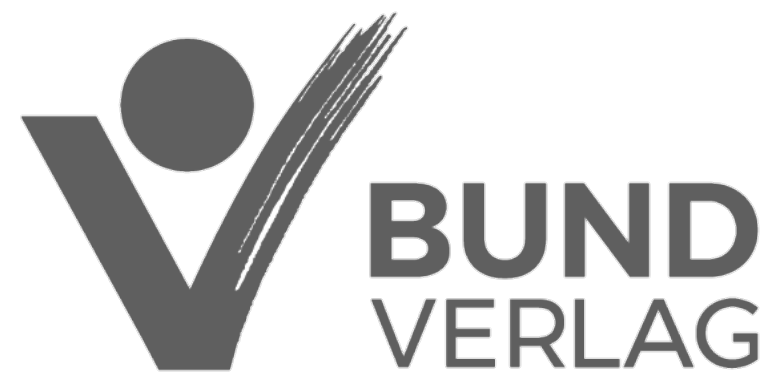Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) im öffentlichen Dienst
Dieser Leitfaden richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Wir erklären, was das BEM bedeutet, welche Chancen es bietet, wo Risiken liegen – und wie Sie sich gut darauf vorbereiten können.
1. Was ist das BEM eigentlich?
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) soll Ihnen helfen, nach längerer Krankheit wieder gut in den Arbeitsalltag zurückzufinden. Die rechtliche Grundlage dieser Wiedereingliederung findet sich in §167 Absatz 2 SGB IX. Wenn Sie innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Ihnen ein BEM anzubieten – egal ob Sie schwerbehindert sind oder nicht.
Das BEM gilt auch für Beamtinnen und Beamte. Die rechtliche Grundlage hierfür ergibt sich aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn und den entsprechenden beamtenrechtlichen Vorschriften. Es ist die Voraussetzung für eine spätere stufenweise Wiedereingliederung (analog zum "Hamburger Modell").
In den Tarifverträgen (TVöD, TV-L, TV-V, u.a.) wird das BEM zwar nicht direkt erwähnt, es wirkt sich jedoch auf tarifliche Regelungen aus. Beispiel § 34 TVöD (Kündigung): Krankheit kann ein Kündigungsgrund sein – aber nur, wenn kein milderes Mittel existiert. Ein durchgeführtes BEM zeigt, dass Alternativen geprüft wurden.
Wichtig: Das BEM ist keine Pflicht – Sie entscheiden selbst, ob Sie teilnehmen möchten.
2. Ihre Rechte und Pflichten
- Sie können frei entscheiden, ob Sie am BEM teilnehmen.
- Sie dürfen selbst bestimmen, welche Informationen Sie weitergeben.
- Gesundheitsdaten sind vertraulich – sie gehören nicht in die Personalakte.
- Sie können eine Vertrauensperson mitbringen (z. B. Personalrat oder Kollegin).
- Sie dürfen das Verfahren jederzeit abbrechen, ohne Nachteile.
3. Chancen und Vorteile für Beschäftigte
- Individuelle Unterstützung bei der Rückkehr in den Beruf.
- Möglichkeit, Arbeitsbedingungen anzupassen (z. B. Arbeitszeit, Aufgaben, ergonomischer Arbeitsplatz).
- Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Personalrat und Personalabteilung.
- Schutz vor krankheitsbedingter Kündigung – ein aktiv durchgeführtes BEM kann dem Arbeitgeber zeigen, dass Alternativen geprüft wurden.
- Sie können eigene Vorschläge einbringen, statt dass „über Sie“ entschieden wird.
4. Mögliche Risiken – worauf Sie achten sollten
Ein BEM soll helfen, nicht schaden. Dennoch kann es Situationen geben, in denen Sie vorsichtig sein sollten:
- Sprechen Sie nicht über Diagnosen oder konkrete medizinische Befunde. Beschreiben Sie lieber Belastungen oder Einschränkungen („Ich kann keine langen Bildschirmzeiten mehr leisten“ statt „Ich habe Migräne“).
- Fragen Sie genau nach, wer im Gespräch anwesend sein wird und wer die Informationen erhält.
- Lassen Sie sich Unterlagen (Einladungen, Einwilligungen, Gesprächsprotokolle) immer aushändigen.
- Wenn Sie sich unsicher fühlen: Ziehen Sie den Personalrat oder die Schwerbehindertenvertretung hinzu.
Ein gut vorbereitetes BEM stärkt Ihre Position – nicht umgekehrt.
5. Tipps für die Vorbereitung
- Notieren Sie, welche Tätigkeiten Ihnen schwerfallen und was Ihnen helfen würde.
- Überlegen Sie, welche Unterstützung Sie brauchen (z. B. flexible Arbeitszeit, ergonomischer Stuhl, Homeoffice-Option).
- Formulieren Sie Wünsche positiv („Ich würde gern schrittweise einsteigen“ statt „Ich kann das nicht mehr“).
- Bitten Sie um Transparenz: Wer führt das Protokoll? Wo werden Daten gespeichert?
6. Beispiel aus der Praxis
Beispiel: Eine Sachbearbeiterin in der Kämmerei war acht Wochen wegen eines Bandscheibenvorfalls krank. Im BEM-Gespräch wurde vereinbart, dass sie zunächst in Teilzeit zurückkehrt, ihr Arbeitsplatz mit einem höhenverstellbaren Tisch ausgestattet wird und sie nach drei Monaten ein Feedbackgespräch erhält. Ergebnis: Sie konnte ohne Rückfall in den Vollzeitbetrieb zurückkehren.
7. Fazit: So nutzen Sie das BEM für sich
Das BEM ist eine Chance, Ihre Arbeitssituation langfristig zu verbessern. Wer gut vorbereitet und informiert in das Gespräch geht, kann konkrete Veränderungen anstoßen. Bleiben Sie selbstbestimmt, lassen Sie sich beraten – und sehen Sie das BEM als Unterstützung, nicht als Kontrolle.